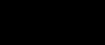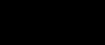|
Neues Deutschland
Gleichheit in Vielfalt:
Vor 50 Jahren starb Anna Siemsen (27./28. Januar 2001)
Am 22. Januar 1951, vier Tage nach ihrem 69. Geburtstag, starb Anna
Siemsen, deren Name eine Jena-Winzerlaer Straße (die frühere
Otto-Schwarz-Str.) seit 1995 trägt.
Die demokratische Sozialistin wurde 1919 ins Volksbildungsministerium
nach Berlin berufen. Interessanter erscheint das Jahrzehnt, das sie
ab 1923 in Jena verbrachte. Hier errang sie 1928 für die SPD ein
Reichstagsmandat, das sie 1930 aus gesundheitlichen Gründen niederlegte.
Ihr oblagen in Thüringen Lehrerbildung sowie Schulreform, die nach
Reichswehreinmarsch und Sturz der sozialdemokratisch-kommunistischen
„Arbeiterregierung“ abgebrochen wurde, was für sie Amtsverlust
bedeutete. Ihr blieb das Engagement für die sozialistische Heimvolkshochschule
Schloß Tinz bei Gera, Volkshochschulen, die in Jena gegründete
„Urania“, in Frauen- und Friedensbewegung, im „Verband
für Freidenkertum und Feuerbestattung“ und die Pädagogikprofessur
an der Universität Jena. Als der Heidelberger Hochschullehrer Gumbel
wegen seines Auftretens gegen Rechtsextremisten suspendiert wurde,
protestierte sie als einzige innerhalb der Hochschullehrerschaft der
Jenaer Universität mit Professoren anderer Universitäten
hiergegen. In Thüringen, wo Nazis schon vor der Hitler-Diktatur
regierten, vergaß man das nicht: sie verlor Weihnachten 1932 die
Lehrbefugnis, emigrierte 1933 in die Schweiz - dort dann zwecks
Umgehung der restriktiven Flüchtlingspolitik Scheinheirat, um publizieren
zu dürfen (Redaktion der Zeitschrift „Die Frau in Leben und
Arbeit“).
„Ja, wenn sie alle so wären wie diese seltene Frau!“, seufzte
Tucholsky 1929 in seiner Rezension von „Daheim in Europa“ (Völkerfreundschaft
und Einigung Europas waren weitere Anliegen Siemsens, die auch in der
Liga für Menschenrechte wirkte).
Schwierigkeiten brachte ihre Geradlinigkeit auch mit der SPD. Sie schrieb
nach dem Leipziger Parteitag der SPD 1931, der das Ende der das Ende
der Jungsozialistenbewegung bedeutete, in der Broschüre „Parteidisziplin
und sozialistische Überzeugung“, daß das „Nichtfolgeleisten
zur sozialistischen Pflicht und äußere Disziplin zum Verrat
an der Sache“ werden könne. Aus der SPD, in die sie, von der linkeren
USPD kommend, 1922 eingetreten war, wechselte sie 1931, wie auch Willy
Brandt, zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands - während
linksaußen der KPD-Schulpolitiker Hoernle höhnte, daß
sie von der „Lösung im Staate der proletarischen Diktatur nichts
weiß“. Trotz Anfeindungen von seiten der verbal eine „Einheitsfront“
propagierenden, faktisch diese verhindernden KPD, rechnete ihr Bruder
August, der 1930 bis 1932 dem Reichstag angehörte und wohl insofern
auch für sie sprach, dort im Februar 1932 mit der Schuld von KPD
und SPD am Zustandekommen einer gemeinsamen Reichspräsidentenkandidatur
ab – und votierte dennoch für Thälmann. Sie blieben für
das KPD-Zentralorgan „die schlimmsten Feinde der Arbeiterklasse“ in
einer „sozialfaschistische Agentur“ (Remmele am 9. März 1932).
Gegen SPD und KPD, die meinten, Hitler würde eine kurze Episode,
warnte Anna Siemsen im Januar 1932, daß dessen Machtergreifung
„vielleicht über Jahrzehnte über das Schicksal der deutschen
Arbeiterschaft entscheiden wird“.
Nach Kriegsende zog sie zu einer Schwester nach Hamburg. Zu erforschen
bleibt, warum Versuche, sie wieder für Jena zu gewinnen, scheiterten.
Widerstände in Hamburgs Universität und Verwaltung verhinderten
den ihr von sozialdemokratischen Landespolitikern versprochenen, angemessenen
beruflichen Wiedereinstieg der Antifaschistin.
Aktuell bleibt ihr Einsatz innerhalb der SAP-Programmdebatte für
eine „demokratische Form, die im Gegensatz zu den bürokratischen
Herrschaftsverhältnissen in der SPD und KPD steht“ und gegen
einen dogmatisierten Marxismus derer, die „mit den Worten des Meisters
seinen Geist totschlagen“ und sich erschöpfen in der „Diffamierung
einer gegensätzlichen Meinung durch das Etikett: Reformist, Zentrist,
Ultralinker. Das erspart jede weitere geistige Auseinandersetzung“.
Aktuell bleibt leider vis-à-vis der heutigen Gewalt von Rechts,
wofür sie 1948 in ihrem Werk „Die gesellschaftlichen Grundlagen
der Erziehung“ eintrat, nämlich für „die Gleichheit
alles dessen, was Menschenantlitz trägt, die Gleichheit des Rechtes
und der Würde in einer mannigfaltig-differenzierten und gegliederten
Vielfalt.
Fern des Dogmas: Der linke italienische
Theoretiker Norbert Bobbio wurde 90 (6./7. November 1999)
- Dem Marxismus-Leninismus vergangener Zeiten, der sich an der Spitze
des Fortschritts wähnte, waren die mehr als 1600 Veröffentlichungen
des renommierten linken Staatstheoretikers keine Zeile wert. Nicht
einmal in den Abhandlungen über Menschenrechte des ketzerischen
DDR-Rechtsphilosophen Hermann Klenner tauchte Noberto Bobbio auf,
der viel zu dieser Thematik verfasst hat. Der von jenem "ML"
legitimierte "reale Sozialismus" ist inzwischen gestorben,
und der Turiner Rechtsphilosoph Bobbio feierte kürzlich seinen
90. Geburtstag und gilt als einer der letzten über Parteigrenzen
hinaus beachteten europäischen linken Intellektuellen, bereits
1984 vom italienischen Staatspräsident, dem alten Antifaschisten
Pertini, als Reorganisator der Republik nach dem Krieg zum Senator
auf Lebenszeit ernannt.
In der DDR hatte man Gelegenheit, einmal etwas von Bobbio zu lesen,
verfügte man über Verbindungen zur Vereinigung Demokratischer
Juristen in der BRD, denn in der auch in der DDR auftauchenden, VDJ-nahen
Quartalsschrift "Demokratie und Recht" erschien auf dem Höhepunkt
der "Eurokommunismus"-Debatte 1976 Bobbios Beitrag "Grundfreiheiten
und gesellschaftliche Formierungen", in dem er wider die den Einzelnen
Staatsbürger entmachtende Dichotomie von "Staat" und
"Individuum" und für einen zwischengeschalteten Pluralismus
"gesellschaftlicher Formierungen", für die Repräsentation
unterschiedlicher Interessen durch "intermediäre Körper",
plädierte.
Mit der Frage nach den Alternativen zur bürgerlichen, repräsentativen
Demokratie, die er mit dem provokatorischen Titel "Gibt es eine
marxistische Staatstheorie?" versah, löste Bobbio 1975 im
theoretischen Organ der Italienischen Sozialistischen Partei "Mondo
Operaio" und in dem der KPI "Rinascita" eine noch heute
lesenswerte Debatte aus - die deutsche Übersetzung dieser linken
Diskussionsbeiträge erschien nicht in Ostberlin, sondern in Westberlin
("Sozialisten, Kommunisten und der Staat - Über Hegemonie,
Pluralismus und sozialistische Demokratie", VSA-Verlag 1977). Des
prominenten Antifaschisten Bobbios Feststellung, dass nicht sozialistische
Theoretiker, sondern der als Faschist angesehene deutsche Staatsdenker
Carl Schmitt lesenswert sei, weil er die radikalste, nämlich tiefgehende
Kritik der repräsentativen Demokratie geliefert habe, muß
SED-Ideologen genauso suspekt gewesen sein wie Bobbios prophtische Verabschiedung
ihres Sozialismusmodell anderthalb Jahrzehnte vor dessen Untergang:
"Zwar ist die Staatsform, die in den sozialistischen Ländern
verwirklicht worden ist, eine Alternative zum repräsentativen Staat:
aber sie ist inakzeptabel. Wenn das wirklich der neue Staat war, über
den schon Verteidigungsreden gehalten wurden, bevor die Entdeckung seiner
Degeneration allgemein bekannt wurde und folglich nicht widerrufen werden
konnte, - begnügen wir uns gerne mit dem alten Staat."
Der Alte, der Doyen der italienischen Staatsrechtslehre, ist agiler
als mancher junge Wissenschaftler. Er ist Mitbegründer und Herausgeber
der neuen Zeitschrift "Reset", die ihren Titel jenem Computerbefehl
verdankt und einem gesellschaftlichen Neuanfang dienen soll. Und als
nach dem Untergang der sozialistischen Länder das Gesellschaftsspiel
mit der englisch so sinnigen Quizfrage "What's left?" die
Gemüter beschäftigte, antwortete er mit einem Buch über
die Rechte und die Linke. Als vor fünf Jahren in Rom sein
Buch "Destra e sinistra" erschien, in welchem er die Linke
mit dem Ideal der sozialen Gleichheit identifizierte, war es ähnlich
erfolgreich wie jetzt Lafontaines politische Kardiologie. Es führte
im Sommer 1994 die Bestsellerliste Italiens an - 15000 Exemplare an
zwei Tagen, 150000 Exemplare in den ersten zwei Monaten (inzwischen
auch ins Deutsche übersetzt).
Angesichts der Krise der Linken könnte man dort gerade auf Bobbio
neugierig sein, der, jenseits des Dogmatismus, schon 1954 sein Dilemma
als kritischer, engagierter Intellektueller sah: "Eher den Kommunisten
verwandt, wenn es sich darum handelt, sich über das Elend, den
Analphabetismus, die antiquierte Struktur des christdemokratischen Staates
der 'Barone' und der Großindustriellen zu empören, fühlen
wir uns aber eher den Liberalen verwandt, wenn es darum geht, für
die Freiheit gegen gewissen Unterdrückungen, Säuberungen und
gewisse Prozesse zu protestieren. Und natürlich werden diese Intellektuellen
gleichzeitig von der einen Seite angeklagt, die 'Schweizer Garden' der
Reaktion zu sein, wie sie von der anderen Seite als 'nützliche
Idioten' des internationalen Kommunismus angeklagt werden." Zum
Studium liegt auf Deutsch auch seine skeptische Schrift über "Die
Zukunft der Demokratie" (Rotbuch-Verlag Berlin/W. 1988) vor, in
der er sich mit nach wie vor aktuellen Wunschträumen von "Basisdemokratie"
und "Bewegungspolitik" auseinandersetzt - und übrigens
auch mit "linker Sparpolitik": mit dem Konzept "revolutionärer
Austerität" im "historischen Kompromiß" des
IKP-Generalsekretärs Enrico Berlinguer vor zwanzig Jahren...
Norberto Bobbio gestorben [13.
Januar 2004]
„Ich verabscheue die Fanatiker aus tiefster Seele.“ Dieses
Selbstzitat steht am Ende des letzten Buchs von Norberto Bobbio „Vom
Alter“. Der am 18. Oktober 1909 geborene und 1984 vom Staatspräsidenten
Pertini, seinem Freund aus Zeiten des antifaschistischen Widerstands,
auf Lebenszeit zum Senator ernannte italienische Staatsphilosoph und
Ziehvater demokratischer Sozialisten ist am Freitag in Turin gestorben.
Am Wochenende ehrten Tausende, darunter Staatspräsident Ciampi
genauso wie FIAT-Chef Agnelli oder der Vorsitzender der IKP-Nachfolgepartei
DS Fassino, den in der Universität Turin Aufgebahrten. Hier vertrat
er 1948 bis 1984 den Lehrstuhl für Philosophie des Rechts und der
Politik. Nur ein einziges Mal, zur Verfassungsgebenden Versammlung 1946,
hat Bobbio mit der fast ausschließlich von Intellektuellen geführten
Partito d'Azione für ein politisches Amt kandidiert – erfolglos.
Als Antifaschist und Demokratie-Theoretiker (nicht nur der italienischen)
war er anerkannt; gerade auch, weil er nicht wegdiskutierte, daß
er 18-jährig zu Mussolinis Faschisten gehörte und daher sich
auch unwürdig sah, nach Kriegsende Kulturpreise anzunehmen, mit
denen er als Antifaschist geehrt werden sollte. Allerdings sprach auch
er hierüber erst spät: „Nun, schlicht, weil wir uns
schämten. Jetzt, mit neunzig Jahren, kurz vor dem Ende meines Weges,
spreche ich darüber.“
Stets kultivierte er eine Debattenkultur, die sich nicht im Dozieren
vor Gleichgesinnten, sondern gerade in der Auseinandersetzung mit Kontrahenten
- etwa Carl Schmitt- bewährte. „Ich habe gelernt, die Ideen
anderer zu respektieren, vor dem Geheimnis innezuhalten, das jedes individuelle
Bewußtsein birgt, zu verstehen bevor ich diskutiere, und zu diskutieren
bevor ich verurteile“, zitierte ich seinem letzten Buch Bobbio
sich selbst, um die Frage zu beantworten, wie er sich „gerne selber
definieren würde“.
Der Linken versuchte er den Juristen Hans Kelsen, dem man Hammer und
Sichel noch heutzutage in einem Staatswappen - dem Österreichs
– verdankt und über dessen „Positivismus“ linke
Ignoranten hinwegsahen, verständlich zu machen.
Bobbio wußte, daß die Freiheit nicht nur vom Staat oder
anderen Individuen, sondern auch von gesellschaftlichen Gebilden („intermediären
Körpern“) bedroht ist. So entwickelte er sein differenzierte
Staats- und Rechtstheorie, der gegenüber viele linke Konzepte idealistisch
und realitätsfern anmuten.
Als 1994 sein Buch „Rechts und links“ nach dem Zusammenbruch
linker Bewegungen und Staaten erschien, stand es für Monate auf
italienischen Bestsellerlisten, da massenhaft Verunsicherte bei ihrem
„laizistischen Papst“ Orientierung suchten. Erfolglos warnte
er gegen die Regierungsübernahme Berlusconis, hinter dem er einen
neuen Faschismus witterte.
Sein letzter Wille war eine nichtkirchliche Beisetzung ohne Ansprachen,
denn es gäbe „nichts so Rhetorisches und Unangenehmes wie
Trauerreden.“
Deutschlandpolitik
der achtziger Jahre - Widersprüchliches in SPD und SED
In den achtziger Jahren engagierte ich mich vor allem bei der Suche
nach Antworten auf die offene "nationale Frage". In der SPD galt ich
daher als Außenseiter, wurde mitunter gar als "Ewiggestriger"
denunziert, der die Unabänderlichkeit und das Segensreiche deutscher
Zweistaatlichkeit ignoriert.
Zur Erinnerung die damaligen Positionen meiner Genossen, die ich nicht
teilte: Mitte 1987 forderte der Berliner Bundestagsabgeordnete Heimann,
immerhin stellvertretender Sprecher für Deutschlandpolitik der
SPD-Bundestagsfraktion, das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes
zu streichen und die deutsche Teilung auf Dauer zu bejahen. Im repräsentativen
SPD-Pressedienst schrieb er, das "Fortbestehen der Bundesrepublik
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik" sei ein
"unbestreitbarer Vorteil". Und auf Nachfrage des Journalisten
Karl Feldmeyer teilte der Sprecher der SPD-Fraktion Steinke mit, es
dürfe angenommen werden, daß Heimann die Meinung der Fraktion
wiedergebe (Frankfurter Allgemeine vom 1. Juli 1987).
Schon vor Gorbatschows "Umgestaltung", aber erst recht seit
Mitte der achtziger Jahre, hielt ich Referate und schrieb Artikel, in
denen ich eine Wiedervereinigung befürwortete. Mitte der achtziger
Jahre sondierten verstärkt Emissäre der UdSSR das Terrain
bundesdeutscher Deutschlandpolitik - als Insider bekam man beispielsweise
die Auftritte Nikolai Portugalows mit, über die allerdings in der
BRD-Presse nichts zu lesen war.

Lafontaine und Schröder am 9. September 1987 mit Honecker während
dessen BRD-Besuchs
Auch in der DDR gab es Überlegungen über eine neue Zukunft
von BRD und DDR. Zwar waren diese nicht so aufsehenerregend wie die
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands [!] in früheren
Jahrzehnten, als Konföderations- und Wiedervereingungspläne
entworfen wurden (mir liegt eine Broschüre vor, die 1959 im VEB
Deutscher Zentralverlag Berlin/Ost erschien: "Friedensvertrag -
Deutschlands Weg zur friedlichen Großmacht"); jedoch geschah,
wie das nachfolgende Interview zeigt, Aufregendes im Stillen:
Professor Jürgen Nitz, Jahrgang 1927, in den sechziger Jahren im
Presseamt beim DDR-Ministerpräsidenten und ab 1969 im Ostberliner
Institut für Internationale Politik
und Wirtschaft (IPW) tätig, überschritt in den achtziger Jahren
als Unterhändler die
Ost-West-Grenzen des Kalten Krieges. Nitz' Ausführungen belegen
außerdem, daß die Sozialdemokraten, die sich überhaupt
noch um die nationale Frage kümmerten, das Schicksal ihrer Landsleute
in der DDR hartnäckiger verfolgten als die deutschen Christdemokraten.
Honeckers Alleingänge - Zeitzeuge Jürgen Nitz erinnert
sich (5. Oktober 1999)
- Bevor es zu Gesprächen auf der »Königsebene«
kommt, werden die Unterhändler ausgeschickt. Sie waren ein solcher.
Unterhändler umgibt immer etwas Geheimnisvolles.
Natürlich sind die Gespräche, die Unterhändler im Dienste
einer Seite führen, nicht für jedermanns Ohr gedacht. Sie sind
streng vertraulich, denn es gilt das Feld zu sondieren, vorzufühlen,
inwieweit ein bestimmtes Projekt machbar ist, die andere Seite bereit
ist, darauf einzugehen. Wenn solche Vorgespräche öffentlich
werden, ist der Schaden groß, kann er sogar irreperabel sein.
- Was muss einen Unterhändler auszeichnen?
Verschwiegenheit, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit. Er muss
das Vertrauen der anderen Seite besitzen. Und er muss geschickt sein,
denn mitunter hat er auf sehr schmalen Grat zu balancieren, muss acht
geben vor Übervorteilung und Preisgabe, damit er seine Auftraggeber
nicht verärgert. Seinen Job macht er gut, wenn er sie zufrieden stellt.
- Wer war Ihr Auftraggeber?
Letztendlich Erich Honecker bzw. die Politbüromitglieder Günter
Mittag für die Gespräche auf wirtschaftlicher und Horst Sindermann
auf politischer Ebene.
- Und wer waren Ihre Gesprächspartner auf der anderen Seite?
In Wirtschaftsfragen der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft bzw. der
Deutsche Industrie- und Handelstag mit Otto Wolff von Amerongen an der
Spitze, bei den politischen Projekten Konfidenten des Bundeskanzleramtes.
- Worum ging es in den Gesprächen?
Mit dem Ostausschuss wurde über die deutsch-deutsche Wirtschaftskooperation
verhandelt, auf der politischen Ebene ging es um Milliardenkredite Bonns
gegen mehr Freizügigkeiten im Reiseverkehr für DDR-Bürger.
- Letzteres war doch auch der Kern des deutsch-deutschen Geheimprojektes
unter dem Codenamen »Züricher Modell«, angeschoben
noch unter der Kanzlerschaft des Sozialdemokraten Schmidt?
Ja, aber das »Züricher Modell« wurde ausmanövriert
durch ein alternatives Projekt, den Milliardenkredit, den Franz Josef
Strauß mit Alexander Schalck-Golodkowksi managte.
- Wo ist da die »Alternative«?
Schalck bekam diesen Kredit ohne Garantie für mehr Freizügigkeit.
- Aber dafür wurden die Minen und Selbstschussanlagen an
der deutsch-deutschen Grenzen abgebaut?
Das wird immer als die Gegenleistung ausgegeben. Aber die Minen hätte
die DDR ohnehin damals auf Grund des internationalen Drucks beseitigen
müssen. Bei den Sozialdemokraten gab es noch den Charme des Junktims.
Bei den Christdemokraten kam die DDR zum Geld wie die Jungfrau zum Kinde,
wie Helmut Schmidt einst zu Honecker bemerkte.
- Das »Züricher Modell« enthielt die Option auf
eine deutsche Konföderation.
Ja. Und das war beiden Seiten klar und von beiden Seiten gewollt. Im Auftrag
von Honecker formulierte damals Herbert Häber, Politbüromitglied,
die Idee von der Koalition der Vernunft, die Kohl mit dem Begriff der
Verantwortungsgemeinschaft beider deutscher Staaten beantwortete. Mit
dieser Konzeption wollte Honecker im Sommer 1984 Moskau für seine
Reise nach Bonn gewinnen. Doch er stieß auf
Ablehnung. Gorbatschow pfiff Honecker zurück wie einen dummen Schuljungen.
- Weil Moskau sich die außenpolitische Initiative auch in
deutsch-deutschen Angelegenheiten nicht nehmen lassen wollte. Für
den Vorstoß Honeckers musste aber einer »bezahlen«.
Genau. Sündenbock war der Verfasser der Annäherungsstrategie:
Häber.
- Aber wie konnte Honecker einen seiner wichtigsten Vertrauensmänner
so einfach fallen lassen?
Stasiminister Mielke spann ein Komplott. Erst wurde ein verleumderisches
Dossier angefertigt, das der politischen Vernichtung von Häber diente.
In diesem war alles Mögliche zusammengetragen worden, u.a. dass Häber
in seiner Oberschulzeit dem »faschistischen Jungvolk« angehört
habe und ein mutmaßlicher Gehlen-Agent sei. Schließlich wurde
auch noch die Geschichte »ausgekramt«, dass Häbers Vater
sich gegen Ende des Krieges an einer Erschießung von Plünderern
nach einem Bombenangriff beteiligt hat. Diese »Information«
erhielt Mielke damals von Häbers Schwägerin, die zum persönlichen
Mitarbeiterkreis der KoKo-Spitze gehörte. Schalck und Mielke waren
Häbers Aktivitäten ein Dorn im Auge. Sie wollten, wie Moskau,
keine Förderung von Projekten, die zur Durchlässigkeit der Mauer
führen würden. Deshalb musste Häber weg. Nach einer unglaublichen
Diffamierungskampagne wurde Häber aus dem Politbüro - offiziell
hieß es: aus Krankheitsgründen - entfernt und sogar in eine
psychiatrischen Anstalt als »hoffnungsloser Fall« abgeschoben.
- War dies auch das Aus der deutsch-deutschen Annäherung?_
Nein. Honecker unternahm noch einen letzten Versuch 1987 während
seines Besuches in der Bundesrepublik. In seiner Rede in Neunkirchen,
im Saarland, schlug er vor, die deutsche-deutsche Grenze so zu gestalten
wie die Oder-Neiße-Grenze. Das war der Kerngedanke des Geheimprojek
tes »Länderspiel«, zu dem ich in Zürich Vorgespräche
mit Thomas Gundelach, Sekretär des damaligen Bundestagspräsidenten
Philip Jenninger, sowie mit dem Bankier Holger Bahl, einem Beauftragten
des Bundeskanzleramtes, führte. Honecker bestand damals nicht einmal
mehr auf den Geraer Forderungen wie die Anerkennung der Staatsbürgerschaft
der DDR. Warum, das begründete Honecker zwei Jahre später, nach
seiner Inhaftierung in der Noch-DDR gegenüber dem damaligen Generalstaatsanwalt:
»Die geschlossenen Genzen zwischen der DDR und der BRD waren nicht
mehr zeitgemäß und brachten menschliche Erschwernisse. Zugleich
wurden sie zunehmend zum Hindernis für die Normalisierung der Beziehungen.«
- Merkwürdig, wo man doch gerade von ihm die Worte von der
noch in 100 Jahren stehenden Mauer im Ohr hat...
...die immer aus dem Kontext gerissen werden und unter anderen Konstellationen
gesagt wurden. Mit seiner Rede 1987 in Neunkirchen jedenfalls hat Honecker
sich erneut Unmut sowjetischerseits zugezogen. Botschafter Kotschemassow
rief an und erklärte erbost, dies sei nicht mit Moskau abgestimmt.
Wieder ein Alleingang des SED-Generalsekretärs.
- Und wie hat Bonn reagiert?
Gar nicht. Denn man wusste nun schon, dass Gorbatschow bereit ist,
die DDR zur Disposition zu stellen. Damit waren alle weiteren deutsch-deutschen
Verhandlungen in dieser Hinsicht uninteressant geworden. Sie wurden
ad acta gelegt.
Hunde auf der Autobahn
sind eine Hoffnung
Heiner Müller wäre jetzt 70 Jahre alt
geworden
In seinen letzten Jahren gab der Dichter Heiner Müller Interviews,
in denen er - gewohnt tonlos und beiläufig - ironische, abgründige,
atemraubend bittere Ungeheuerlichkeiten produzierte, die ich im heutigen
juste milieu der political correctness, nach dem Tod Müllers
und Ernst Jüngers, noch stärker vermisse. Müller: »Ich
sage, was mir in den Kopf kommt«. Was wie ein spöttischer
Selbstverweis auf eine gewisse Unbedenklichkeit klingen mag, zielt ins
Zentrum einer Jahrhundertbegabung: Dieser Dramatiker verfügte über
die Fähigkeit, das Material Leben hemmungslos auf kälteste,
böseste, witzigste Punkte zu bringen, an denen Erfahrung nicht
mehr durch Behauptung von gesicherten Zusammenhängen geschützt
ist.
Müller (geb. 1929 in Eppendorf, gest. Ende Dezember 1995 in
Berlin) war nicht zynisch. Aber wegen einer Hoffnung, die im Chor gesungen
wurde, hat er nie das Gesicht seiner Verzweiflung verraten. Er arbeitete
nicht mit Kategorien wie richtig oder falsch, Fortschritt oder Moral,
Sieg oder Niederlage. Das taugt nicht für ein Zeitgefühl »zwischen
Eiszeit und Kommune«. Und nie wollte Müller verstanden werden
als einer, auf den man sich berufen darf: »Bleib weg von mir der
dir nicht helfen kann«. »Neues Deutschland« veröffentliche
am 8. Januar 1999, zusammengestellt von Hans-Dieter Schütt, von
A bis Z einige Müller-Stichworte zum Nach-Denken [GPl]:
ARBEITERKLASSE
Der Nationalsozialismus war eigentlich die größte historische
Leistung der deutschen Arbeiterklasse. Denn der Zweite Weltkrieg war
der erste wirklich technologische Krieg, Krieg auf der Basis der leistungsfähigen
Industrie, auf der Basis von Geschwindigkeit, Motor und Maschine - und
das ist Arbeiterklasse.
BAUTZEN
Was die Vereinigung für Deutschland bedeutete? Vierzig Jahre Bautzen
verdrängen vier Jahre Auschwitz. Ich wußte schon 1945 alles
über die DDR.
COMPUTER
Am Computer vorbei gibt es wohl keine Utopie mehr. Nur hat das auf
einem so engen Raum wie Japan natürlich andere Folgen als in der
Sowjetunion mit ihrer riesigen Landmasse. Da verändert sich eher
der Computer und fängt an, Wodka zu trinken oder zu versteppen.
DEUTSCHE EINHEIT
Für das Ende des soeben vergehenden Jahrtausends wurde übrigens
schon von Nostradamus prophezeit, daß der Islam Europa besetzt.
Das hätte den Vorteil, daß nicht mehr alle in diesen blöden
Anzügen und mit Krawatte herumlaufen, sondern im nordafrikanischen
Burnus - das ist viel bequemer. Jeder darf zehn Frauen haben oder zwanzig,
so er sich's leisten kann. Dann könnte man sagen: Das Ergebnis
der deutschen Einheit war der Harem.
EINSAMKEIT
Das Boot ist voll. Auf der Tagesordnung steht der Krieg um Schwimmwesten
und Plätze in den Rettungsbooten, von denen niemand weiß,
wo sie noch landen können, außer an kannibalischen Küsten.
Mit der Frage, wie man diese Lage seinem Kind erklärt, ist jeder
allein. Und vielleicht ist diese Einsamkeit eine Hoffnung.
FEINDSCHAFT
Es gibt eine These, die ich ganz gut finde: Es geht darum, alle Feinde
des Kapitalismus zu liquidieren, alles, was ihm hinderlich ist - damit
er mit sich ganz allein ist. Und dann kann er seine Widersprüche
voll entwickeln - dann ist der Kapitalismus nämlich sein eigener
Feind. Das ist wahrscheinlich die Chance für eine Implosion.
GENUSS
Ich neige heute noch, zum Beispiel in der Fußgängerzone,
zu Haßanfällen gegen das Geschmeiß, das seine Scheiße
in die Dritte Welt karrt im Tausch gegen ihre Produkte. Das ist unausrottbar.
Aber auch der Stachel, wenn ich mich dem Genuß anschließe
und es schmeckt mir ... Wenn man durch eine Einkaufs~passage in Düsseldorf
spaziert, stößt man auf massenhaften Lebensersatz. Da wird
Kunst plötzlich Terror und bekommt die Aufgabe, dieses Leben auszulöschen,
denn das Leben in Düsseldorf ist nicht lebenswert. Fünftausend
rosa Slips bejahen nicht das Leben. Das schreit vielmehr nach Tod und
Vernichtung, wie die Postkartenhäuser am Chiemsee. Jedes Haus ist
so zu Ende geputzt, daß Umweltverschmutzung zur letzten Hoffnung
wird.
HAMBURGER
Die an die neue Welt gewöhnten Kinder brauchen weder Kunst
noch Literatur oder Theater. Die werden nie im Leben auf die Idee
kommen, daß ein Gedanke interessant sei, der sich nicht in
Hamburger umsetzen läßt.
IDEE DES KOMMUNISMUS
Von Ernst Bloch gibt es die schöne Definition: Die moralische
Überlegenheit des Kommunismus besteht darin, daß er für
den einzelnen keine Hoffnung hat. Also, wenn die sozialen, ökonomischen
Probleme gelöst sind, dann beginnt die Tragödie des Menschen:
die Tragödie seiner Einsamkeit. Der einzelne wird auf seine eigentliche
Existenz reduziert ... Die Angebote des Kapitalismus zielen auf Kollektive.
Aber sie sind so formuliert, daß sie die Kollektive sprengen.
McDonald's ist das absolute Angebot von Kollektivität. Man sitzt
überall auf der Welt in derselben Kneipe, frißt die gleiche
Scheiße, und alle sind glücklich. Der Kapitalismus kann einem
immer nur was geben, indem er die Leute von sich selbst wegbringt.
JAHRTAUSEND
Wenn ein Mensch in seiner Höhle den Mund aufmacht nach tausendjährigem
Schweigen und zu seiner Frau sagt: »Ich kann dich nicht mehr sehen«
- genau in dem Moment beginnt Geschichte ... Wenn man eine attraktive
Frau sieht und den spontanen oder natürlichen Impuls verspürt,
sich ihr zu nähern, kann man das aus dem Stand nur, wenn man betrunken
oder verrückt ist. Dazwischen liegend dreitausend Jahre Geschichte
- Moral und Geschlechterkampf. Also schafft die Geschichte Verstümmelung.
KZ
Brodsky erzählt in seinen Leningrader Erinnerungen eine Episode
mit seinem Vater, der als Jude nicht Offizier werden konnte und wehmütig
die Militärkapellen betrachtete, zu denen er gern gehört hätte.
Und dann fragte der Junge: »Welche KZs sind schlimmer, deutsche
oder sowjetische?« Der Vater ohne Zögern: »Die sowjetischen.«
Der Junge fragt: »Warum?« - »In den deutschen wirst
du getötet, in den russischen wirst du gezwungen, darin einen Sinn
zu sehen.«
LENIN
Historisch gesehen, beginnt die Tragödie des deutschen Kommunismus
mit der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die zur totalen
Abhängigkeit von Lenin beziehungsweise der KP der Sowjetunion führte.
Die deutschen Kommunisten haben sich von dieser Enthauptung nie wieder
erholt, von dieser zunehmenden Enthirnung der deutschen kommunistischen
Partei ... Es gab einen Versuch, Marx zu widerlegen. Der Initiator des
Versuchs war Lenin. Dieser Versuch ist mit dem Ende der Sowjetunion
gescheitert.
MÄNNERWANDERUNG
Dies ist die deutsche Männerwanderung des 20. Jahrhunderts - aus
den Schrecken der Inflation auf der Ketten- und Bombenspur in die Bordelle
von Bangkok.
NOVEMBER 1989
Am 4. November 1989, auf dem Alexanderplatz, da habe ich die Unmöglichkeit,
mit 500 000 Menschen zu reden, sehr stark empfunden. Man erschrickt
erstmal, wenn von 500 000 vielleicht 20 000 »Buh« rufen,
aber dann macht es auch plötzlich Spaß, dann wird es wieder
Krieg, dann ist es gut. Das Kriegerische ist eine Grundfrage in allen
gesellschaftlichen Begegnungen und Verhältnissen.
OZONLOCH
Vor der Festung stehen zig Millionen der Elenden und wollen herein.
Es ist eine Illusion zu glauben, daß Europa in der Defensive zu
halten ist. Der Sieg des Kapitalismus leitet sein Ende ein, denn man
kann nicht erobern, was sich einem an den Hals schmeißt. Daran
kann man sich nur verschlucken. Der Kapitalismus, der traditionelle
Aggressor Europa, ist jetzt plötzlich von Asien und Afrika umzingelt
und steht mit dem Rücken zum Ozonloch.
PARTISANEN
Es geht heute um die Wiedergeburt des Revolutionärs aus dem Geist
des Partisanen: Mag der Partisan in einer Industriegesellschaft ein
Hund auf der Autobahn sein. Es kommt darauf an, wie viele Hunde sich
auf der Autobahn versammeln.
QUALITÄT DER DDR
Die DDR war ein Geschenk für eine Generation von besiegten Kommunisten,
Emigranten, Zuchthäuslern, KZlern, die hier einen schönen
Lebensabend verbringen durften. Die einzige Legitimation der DDR kam
aus dem Antifaschismus, aus den Toten, aus den Opfern. Deshalb war der
Sozialismus auch ein Hort der Langsamkeit, denn die Toten haben unendlich
Zeit. Ab einem gewissen Punkt fing es an, zu Lasten der Lebenden zu
gehen. Es kam zu einer Diktatur der Toten über die Lebenden - mit
allen ökonomischen Konsequenzen. Denn die Toten brauchen keine
Jeans, keine Kiwis, keinen Walkman.
REUE
Ich bereue grundsätzlich nichts. Das ist eine völlig unproduktive
Haltung. Ich hab auch gar kein Recht, rein zu sein in einer schmutzigen
Welt.
SED
Ich kann der SED nicht sehr dankbar sein: Sie hat mir verboten, kleine
sozialistische Geschichten aus der Produktion zu machen und mich also
dazu verdammt, Weltliteratur zu schreiben.
TERROR
Man muß die Mauer in der DDR auch mal historisch sehen. Die erste
Maßnahme der Französischen Revolution, über die im Konvent
beraten wurde, war die Schließung der Grenzen. Damit hat diese
sogenannte freie Gesellschaft begonnen. Die Begründung der freien
Marktwirtschaft geschah durch Terror.
UNTERSCHIEDE
Programm und Realität stimmten bei den Nationalsozialisten überein.
Im Stalinismus war die Differenz zwischen Programm und Realität
entscheidend. Diese Differenz ist der Grund, weshalb die stalinistischen
Strukturen solche Anziehungskraft für Intellektuelle hatten. Sie
schafft einen Leerraum, der Phantasie ermöglicht.
VORSPRÜNGE
Der Vorteil der DDR-Erfahrung ist, daß da keiner die Illusion
hat, unschuldig zu sein. Zu dieser Erfahrung gehört das Gefühl
von Komplizenschaft, von irgendeinem Anteil an allem, was in der Welt
so schiefläuft. Und das ist ein großer moralischer Vorsprung.
Im Westen wiederum gibt es, gegenüber dem Osten, vor allem einen
Vorsprung an Verblödung.
WIRTSCHAFTSWUNDER
Das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges war die Gesundschrumpfung des
deutschen Territoriums auf den ökonomisch potenten Kern: Bundesrepublik.
Das Wirtschaftswunder ist eine Leistung von Hitler, nicht von Erhard.
ZUKUNFT
Vielleicht gibt es irgendwann eine humane Gesellschaft - eine Gesellschaft
also, in der man keine Kunst braucht.
Weder Dämon
noch Heros: Vor 100 Jahren starb Otto von Bismarck - ein Mann im Widerstreit
(30. Juli 1998)
Von Ernst Engelberg
(Der DDR-Historiker war Verfasser jener als gesamtdeutsches
Ereignis gefeierten Bismarck-Biographie, die in den 80er Jahren in
der BRD Werbeprämie der nicht irgendwelcher SED-Sympathien verdächtigen
FAZ war)
Der 100. Todestag Otto von Bismarcks und 150 Jahre nach der 48er Revolution
- ein geradezu symbolkräftiges Zusammentreffen. War es doch der
sogenannte Vormärz, der Bismarck zum politischen Agieren brachte,
und blieb doch die Revolution von 1848 ein folgenreiches politisches
Grunderlebnis für ihn.
Denn zunächst bewegte ihn in seiner Jugendzeit nur ein unbändiger
Drang nach Persönlichkeitsentfaltung, der ihn alle vorgezeichneten
Wege einer für seine Kreise konventionellen Laufbahn meiden ließ.
Dem Drängen der Eltern, »Soldat zu werden«, hätte
er, wie er sagte, mit »siegreicher Festigkeit« widerstanden.
Doch auch eine Laufbahn im Verwaltungsdienst war nicht nach seinem Geschmack.
Da beklagte er »die körperlich und geistig eingeschrumpfte
Brust, welche das Resultat des Beamtenlebens sein werde.«
Unbefriedigt und unausgefüllt lebte er sich zunächst als »toller
Junker« aus, ahnungsvoll, daß ihn weniger auf dem »breitgetretenen
Weg, durch Examen, Connexionen, Actenstudium und Wohlwollen« seiner
Vorgesetzten Erfolge reizen würden, vielmehr aber könnten
die »eines Mitspielers bei energischen politischen Bewegungen«
auf ihn »eine jede Überlegung ausschließende Anziehungskraft
ausüben, wie das Licht auf die Mücke.«
Diese für ihn ersehnte Konstellation reifte in den Jahren vor
der 48er Revolution heran, als sich Bismarck zunächst führenden
pommerschen Pietisten annäherte, mit denen ihn sein Grundbesitzerinteresse
wie sein politisches Credo verbanden. Es war also die erzkonservative
Seite, die Bismarck, wie viele spotteten, zu ihrem »Adjutanten«
machte.
In der Tat bewegte ihn wilder Fanatismus gegen die demokratisch-antidynastischen
Bewegungen des Volkes und ein starker Wille, die preußische Krone
niemals von liberalen Parlamentsmehrheiten abhängig werden zu lassen.
Ein Brief an seine Frau vom September 1849 gibt Bismarcks innere Einstellung
zur Revolution mit allem Ingrimm wider. Hatte er doch mit seiner Schwester
die Gräber der Märzgefallenen im Berliner Friedrichshain besucht
und grollte, daß er nicht einmal den Toten vergeben könne.
»Mein Herz war voll Bitterkeit über den Götzendienst
mit den Gräbern dieser Verbrecher, wo jede Inschrift auf den Kreuzen
von Freiheit und Recht prahlt, ein Hohn für Gott und Menschen.«
So vorgeprägt, brachte Bismarck die Gunst Leopold von Gerlachs,
des Hauptes der Kamarilla um Friedrich Wilhelm IV., als preußischen
Bundestagsgesandten nach Frankfurt, wo er rasch erkannte, daß
von hier aus die Welt anders aussah als von der pommerschen Ackerfurche
her. In jener diplomatischen Gesellenzeit am Bundestag beunruhigte er
schließlich seinen Gönner durch zahlreiche Briefe, in denen
er sich mit dessen pietistisch-dogmatischem Denkstil auseinandersetzte
und, neue Erfahrungen nutzend, seinen eigenen entwickelte. Auffallend,
wie oft er in den Briefen an Gerlach von einem »Plan« spricht,
den man im Politischen haben müsse. Man könne die Dinge nicht
einfach treiben lassen. Was er zu dieser Zeit darunter verstand, wird
deutlich: er will das preußische Hegemoniestreben mit der nationalstaatlichen
Einigung Deutschlands verbinden - unter Ausschluß Österreichs.
Nicht verwunderlich, daß die Österreicher den sich unverblümt
äußernden Diplomaten anläßlich des Regierungswechsels
gegen Ende der 5Oer Jahre nach Rußland wegintrigierten. Zunächst
traf das Bismarck hart, der sich »kaltgestellt« fühlte
an der Newa. Nur die antiösterreichische Partnerschaft, die er
schließlich mit dem russischen Reichskanzler Gortschakow einging
- wie Hand und Handschuh würden sie zusammenpassen -, versöhnte
ihn.
Mit neuem Erfahrungsgewinn reifte für Bismarck die Zeit, in der
er gegen anfängliche Widerstände seitens König Wilhelms
vonnöten war, um im Heeres- und Verfassungskonflikt die parlamentarischen
Ambitionen der Liberalen abzuwehren.
Im September 1862 zum Ministerpräsidenten und Außenminister
ernannt, erreichte er schließlich über drei Kriege sein Ziel:
die nationalstaatliche Einigung. Zunächst brachte Bismarck 1863
das Kunststück fertig, als Schleswig von Dänemark annektiert
werden sollte, den strategischen Hauptgegner Österreich zum taktischen
Verbündeten zu machen. Zugleich konnte er mit den militärischen
und politischen Erfolgen in Schleswig-Holstein die Liberalen in die
Defensive bringen. Die Differenzen mit Österreich über die
Verwaltung der beiden Herzogtümer verschärfte er dann im Herbst
1865 derart, daß 1866 eine kriegerische Auseinandersetzung unumgänglich
wurde. Und die im Frühjahr des Jahres erstarkende Volksbewegung
irritierte er durch den Vorschlag, ein deutsches Parlament aus allgemeinen,
gleichen und direkten Wahlen hervorgehen zu lassen. So wandelte sich
der Konfliktsminister zum Testamentsvollstrecker liberal-demokratischer
Aspirationen von 1848.
Immer wieder tauchen Bismarcks Worte von »Eisen und Blut«
auf, meist in anklagender Weise. Wenn man allerdings nur dem martialischen
Klang nachhorcht, gerät leicht ins Vergessen, daß sie in
einer Epoche blutiger Einigungskriege und nationalrevolutionärer
Aufstände ausgesprochen wurden. Man denke an Belgien, an Polen,
an den relativ harmlosen Sonderbundskrieg in der Schweiz, an die militärischen
Kampagnen in Italien und an den besonders grausamen Sezessionskrieg
in den USA während der Jahre 1861 bis 1865. In der Tat wurden eben
damals die großen Fragen der Zeit durch »Eisen und Blut«
gelöst. Bismarcks radikale Gegner dachten darüber nicht anders.
So schrieb 1866 der badische Demokrat Ludwig Eckhardt, daß »diese
Einheitsfrage eine revolutionäre« sei, die »mithin
nur auf dem Wege der Gewalt ... entweder von oben herab ... oder von
unten herauf, durch das Volk« gelöst werden könne.
Es war dann Otto von Bismarck, der nach dem preußischen Sieg
über Österreich die Revolution von oben vollzog. Preußen
annektierte Hannover, Nassau, Kurhessen und Schleswig-Holstein und rundete
damit sein geographisch durch Hannover und Kurhessen auseinandergerissenes
Staatsgebiet ab. Mit der Annexion wurden drei Fürsten entthront
- gegen alle Prinzipien der Legitimität und des Gottesgnadentums.
Begreiflich, daß der Zar darüber ungehalten war. Doch Bismarck
ließ ihm sagen, es sei besser, eine Revolution zu machen als eine
zu erleiden.
Der bekannte Liberale Ludwig Bamberger zog in einer zunächst in
Frankreich erschienenen Schrift gleichsam ein Fazit, indem er schrieb,
daß Bismarck - allen illiberalen Zügen seines Wesens zum
Trotz - letzten Endes im Dienste der 1789 begonnenen bürgerlich-kapitalistischen
Revolution agiere.
Als nach 1866 die Vereinigung von Nord- und Süddeutschland, wenn
auch nur durch ein Zollparlament, auf Widerstand in Bayern und Württemberg
stieß, erhöhte das die Gefahr einer Intervention durch Frankreich,
zumal sich Napoleon III. in einer innenpolitischen Krise befand. So
ließ sich Frankreich durch die berühmt-berüchtigte Emser
Depesche zur Kriegserklärung provozieren und damit zum letzten
der preußisch-deutschen Einigungskriege.
Otto von Bismarck konnte dann im Jahre 1871 im allgemeinen Siegestaumel
verhängnisvolle Entscheidungen nicht verhindern. Dazu gehörte
die für Frankreich schmerzliche Annexion von Elsaß und Lothringen,
die zukunftsbelastend war, wie er wohl erkannte. Schon darum bemühte
er sich, als Grundlage seiner zukünftigen Außenpolitik in
der von ihm verfaßten Thronrede vom März 1871 die territoriale
Saturiertheit des Reiches zu betonen und die Nichteinmischung in fremde
Angelegenheiten zu proklamieren.
Neue innenpolitische Probleme bedrängten nun den Kanzler, der im
Deutschen Reichstag nicht mehr allein mit der liberalen und der konservativen
Partei zu tun hatte, sondern auch mit der im Winter 1870/71 gegründeten
Katholischen Zentrumspartei, der er schon wegen ihrer Kontakte mit der
Päpstlichen Kurie in Rom mißtraute; erst recht erregten sich
die Liberalen in ganz Europa wegen des vom Vatikanischen Konzil von
1870 verkündeten Dogmas von der Unfehlbarkeit des Papstes. Rudolf
Virchow prägte damals den Begriff vom »Kulturkampf«,
der gegen den unduldsamen Geist der Kirche geführt werden müsse.
Das rein Dogmatische des Vatikanischen Konzils hat Bismarck kaum interessiert.
Besorgt war er zunehmend wegen dreier Aspekte des Konzils und der päpstlichen
Kundgebungen: es ging um die klerikalen Machtansprüche im Staat,
nicht zuletzt im Unterrichtswesen, um zentrifugale Kräfte im Reich
und deren überzogenen Partikularismus, und schließlich um
eine befürchtete katholische reichsfeindliche Liga etwa zwischen
Österreich, Italien und Frankreich. Deshalb bekam der preußische
Kultusminister Adalbert Falk weitgehend freie Hand für die Ausarbeitung
einer antiklerikalen Gesetzgebung.
Das Kirchenvolk war hart betroffen von der rigorosen Handhabung der
Kulturkampfgesetze, von der Verhaftung von Priestern, Kaplänen
und Bischöfen; mitunter verwaisten Pfarreien monate-, ja jahrelang.
Erst Ende der 70er Jahre lenkte Bismarck ein, was begünstigt wurde
durch den neuen kompromißbereiten Papst Leo XIII. So kam für
die katholische Kirche das Ende der Verfolgungen, aber wesentliche Kulturkampfgesetze,
etwa das der Zivilehe, blieben.
Inzwischen spitzten sich die sozialen Konflikte mit den Arbeitern zu;
die Sozialdemokratie war durch die Vereinigung ihrer beiden Flügel,
der Lassalleaner und der Marx-Anhänger, im Jahre 1875 erstarkt.
Den Gefahren, die Bismarck witterte, begegnete er auf verschiedene Weise:
mit Repressionen und mit sozialpolitischen Konzessionen, »mit
Zuckerbrot und Peitsche«, sagte man damals.
Die Peitsche, das war das im Jahre 1878 im Reichstag durchgebrachte
Ausnahmegesetz gegen die Sozialdemokratie, ihre Organisationen und Presseorgane;
auch nahezu alle Gewerkschaften traf das Verbot. Die vielfältigen
Repressionen, angefangen von Hausdurchsuchungen über den Verlust
des Arbeitsplatzes bis zu Rufmord, Inhaftierungen und den für die
Familien so leidvollen Ausweisungen aus den Wohnorten, blieben im Gedächtnis
der politischen Arbeiter unvergessen.
Das Zuckerbrot waren die durch die Sozialversicherungsgesetze gewährten
Kranken-, Unfall-, Alters- und Invalidenversicherungen. Sie erwiesen
sich selbst für außerdeutsche Länder als zukunftsweisend,
erfüllten aber zu damaliger Zeit nicht den verfolgten Zweck, denn
die Sozialdemokratie erstarkte dennoch von Wahl zu Wahl in beindruckender
Weise. Waren doch die Leistungen der Sozialversicherung noch viel zu
gering, zumal sie keine Fabrikgesetzgebung ergänzte, die sich etwa
auf die Arbeitszeit oder den Arbeiterschutz bezog. Mit »Abschlagzahlungen«
aber wollte man sich nicht begnügen. Mit schier unglaublicher Hartnäckigkeit
sträubte sich Bismarck gegen den Arbeiterschutz, wie ihm überhaupt
die Fabrikarbeiter und ihre Welt zutiefst fremd blieben. Nie besuchte
er einen Betrieb, und daß man zu steinernen Dingen wie Städten
eine Beziehung haben könnte, war ihm unbegreiflich. Immer fehlte
ihm die Einsicht, wo er keine Anschauung besaß.
Alles verhielt sich anders auf dem Gebiet der Außenpolitik, wo
er mit Umsicht und Vorsicht agierte, die prekäre Lage des Reiches
in der Mitte Europas immer im Sinn. Schon deshalb betonte er ständig
die territoriale Saturiertheit und ging von der Nichteinmischung in
fremde Angelegenheiten aus. Das schwer errungene Reich wollte er durch
ein Gleichgewicht der europäischen Großmächte sichern,
ein russisch-französisches Bündnis verhindern und Deutschland
davor bewahren, in Balkanhändel militärisch hineingezogen
zu werden. Daher das Dreikaiserabkommen zwischen Deutschland, Rußland
und Österreich, deshalb auch der Rückversicherungsvertrag
mit Rußland. Erst als dieser von seinen Opponenten in Berlin nicht
erneuert wurde, förderten sie die französisch-russische Annäherung,
die zum Bündnis von 1893 führte; die drohende Ost-West-Einklammerung
erweiterte sich ab 1903 durch England zur Gefahr einer Einkreisung.
Was Bismarck befürchtet hatte, zeigte sich jetzt in vollem, katastrophalen
Ausmaß.
Rußland wurde allmählich bereit für ein antideutsches
Einvernehmen mit der kriegsentscheidenden Weltmacht England, die man
in auftrumpfender Weise durch den Bau von Großkampfschiffen reizte.
Da erhielt Bismarck von höchst ungewöhnlicher Seite Unterstützung,
denn in seiner Reichstagsrede vom 11. Dezember 1897 sagte August Bebel:
»Ich stimme mit dem Fürsten Bismarck sehr selten überein,
aber in dem einen hat er unzweifelhaft recht, das er vor einigen Monaten
durch sein Organ in Hamburg verkünden ließ. Er sei der Meinung,
daß die Schaffung einer Flotte, wie sie jetzt geplant wäre,
außerordentlich Bedenkliches hätte.« Deutschland konnte
durchaus ohne Schlachtschiffgeschwader auf die Weltmärkte gelangen.
Es bestand kein determinierter Zusammenhang zwischen dem Ringen um ökonomische
Einflußsphären und einer provokanten Politik der Rüstung
zur See.
Voller Unruhe sah Bismarck die Zeichen an der Wand, als alle seine Mahnungen
zur Mäßigkeit überhört oder als lästig empfunden
wurden, auch vom 31jährigen Max Weber, der 1895 die Einigung Deutschlands
einen Jugendstreich der Nation nannte, der besser unterlassen wurden
wäre, wenn er "der Abschluß und nicht der Ausgangspunkt einer
deutschen Weltmachtpolitik sein sollte.«
Man kann Bismarck nicht anlasten, was seine Nachfolger angerichtet
haben, die ganz bewußt außenpolitisch einen anderen Kurs
steuerten. Noch zwei Jahrzehnte, in denen sie Bismarck nicht mehr zu
fürchten hatten, lenkten sie das Staatsschiff, ehe es im Ersten
Weltkrieg zerschellte. Erst recht geht es nicht an, Hitlers Weltmachtswahn
auch nur annähernd in Beziehung zu Bismarck zu setzen. Und wenn
Kritiker heute nicht zu Unrecht auf die mangelnde parlamentarische Fundierung
des Reiches verweisen, so befinden sie sich damit gar nicht so weit
entfernt von der Meinung des alten Bismarck, daß das Reich nun
»ein starkes Parlament als Brennpunkt des nationalen Einheitsgefühls«
brauche.
Man sollte Bismarck weder als Dämon noch als Mythos stilisieren,
er war auch kein Opportunist, selbst wenn er Opportunitäten zu
nutzen wußte. Von einem nüchternen Empirismus ausgehend,
schätzte er für einen zeitlich und räumlich begrenzten
Umkreis die Kräfteverhältnisse und die handelnden Menschen
realistisch ein und entwickelte jene Strategie und Taktik, die die Reichsgründung
von 1871 möglich machte. Damit war ein Nationalstaat geschaffen,
der zwei Weltkriege und eine 40jährige Spaltung überdauert
hat. Selbst in dem weltweiten Beziehungsgeflecht heute verändert
sich wohl der Zusammenhang, in dem die Nationen stehen, nicht aber deren
historische Existenz. Die gelegentlich zu beobachtende Abwertung der
Nationen erscheint bedenklich, weil sie Gegenteiliges, nämlich
Nationalismus, hervorrufen kann.
Auch bei kritischer Sicht bleibt Bismarcks kraftvolles und einfallsreiches
Wirken für einen Nationalstaat, den schließlich auch die
bejahten, denen es um eine andere Ausgestaltung ging und heute noch
geht.
Die Fast-Food-Ideologie:
Essen für Befehlsempfänger
Interview mit Wolfram Siebeck
Er gilt als Deutschlands feinste Zunge. Diesen Ruf hat er sich erarbeitet:
»Als Feinschmecker kommt man nicht auf die Welt.« Wolfram
Siebeck, 1928 in Duisburg geboren, begann seine publizistische Karriere
1967 als Illustrator und Pressezeichner. Zum Profi-Esser wurde er, als
ihm bei einem Filmfestival das Programm zu langweilig wurde und er sich
ins Restaurant verdrückte. Mit feinsinnigen und scharfzüngigen
Kolumnen avancierte er zum Gourmet-Guru. Seine Bücher sind Bestseller,
u.a.: Kochen bis aufs Messer (1982), Eine Prise Süden (1984), Liebe
auf den ersten Biß (1985), Nicht nur Kraut und Rüben (1985),
Vorsicht, bissiger Hummer (1986), Frisch gewürzt ist halb gewonnen
(1987). Seine Memoiren erschienen 1992 unter dem Titel »Das Haar
in der Suppe hab' ich nicht bestellt«. Wolfram Siebeck lebt in Frankreich.
Die französische Regierung schlug ihn 1991 zum Ritter. Seither ist
er nicht mehr nur Feinschmeckerpapst, sondern auch »Chévalier
du Mérite Agricole [18./19. Juli 1998].
* Herr Siebeck, ist das Thema Fast Food für einen Feinschmecker
wie Sie nicht eher etwas unappetitlich?
Unappetitlich ist das falsche Wort. Ich halte Fast Food für eine
Katastrophe. Dieser konfektionierte Schund entfremdet die Menschen von
natürlicher Nahrung, läßt ihre Fähigkeiten, Nuancen
zu erkennen, verkümmern und bewirkt eine kulinarische Gleichmacherei.
Den individuellen Geschmack der Einzelnen verwandelt Fast Food in Massengeschmack.
Das ist nicht unappetitlich, das ist politisch relevant.
* Inwiefern?
Weil Menschen, die sich gleichschalten lassen, wenn es um die Akzeptanz
einer Kunstpizza, eines Fleischklopses oder einer Tütensuppe geht,
sich auch gleichschalten lassen bei Problemen des gesellschaftlichen
Lebens. Egal ob die Massen »Lecker!« oder »Heil!«
brüllen, es müssen ihnen zunächst einmal der kritische
Verstand beziehungsweise die kritische Zunge lahmgelegt werden.
* Schelten Sie jetzt die Massen oder den Fleischklops?
Einen Fleischklops, womit ich natürlich Hamburger meine, kann
man ebenso wenig schelten wie eine Tütensuppe. Es sind immer die
Verbraucher - oder die Wähler - die für die Existenz von Monstrositäten
verantwortlich sind. Im übrigen kann ein selbstgemachter Fleischklops
ganz lecker sein.
* Vorsicht: Spätestens, seit John Caray sein Buch »Haß
auf die Massen« herausgab, weiß man: Es waren die Intellektuellen,
welche die Masse und ihr Attribut, die Konservenkost, diskreditierten
- als mechanisch und seelenlos.
Was Caray sagt, ist eine Behauptung. Seine Kronzeugen sind wie George
Bissing entweder schrullig oder, wie H.G. Wells, völlig im Recht,
wenn sie gegen Ungeschmack und Pöbel polemisieren. Im übrigen
ist Caray, wie Engländer ganz allgemein, viel stärker von
Klassenunterschieden fasziniert als Kontinentaleuropäer, was seine
Thesen so verbindlich macht wie ein Kochbuch, das nur Gurkenrezepte
enthält.
* Schon die Basare im alten Orient sollen Fast-Food-Paradiese
gewesen sein, und die älteste Würstchenbude der Welt wurde
1134 gegründet. Aber erst unser Jahrhundert wurde das Jahrhundert
der Fast-Food-Philosophie. Warum?
Man kann die Basare und die Würstchenbuden, wo die Produkte ja
frisch gemacht wurden, nicht mit den im Labor gezeugten, mit Chemie
hochgepäppelten und dann tiefgefrorenen Kunstprodukten vergleichen.
Handarbeit und computergesteuerte Maschinen sind zwei verschiedene Welten.
* Fast Food ist an die Industrie und die mit ihr entstandenen
urbanen Massen gebunden?
Fast Food ist die industrielle Umsetzung der Erkenntnis, daß
der Mensch bequem war, bequem ist und bequem bleiben wird. Aus Bequemlichkeit
haben wir all die tollen Sachen erfunden, die uns die Arbeit erleichtern,
beispielsweise die Arbeit, unsere Mitmenschen umzubringen. Die haben
wir ziemlich perfektioniert, wie Sie zugeben werden.
Aber der Mensch ist auf allen Gebieten bequem. Ein Wunder, daß
wir noch freiwillig kauen, was wir hinunterschlucken. Wir sind zu bequem,
Feuer zu machen, Suppen zu kochen und Orangen auszupressen. Wir wollen
zwar essen, aber wenn's geht, dafür nicht kochen müssen. Die
»Speisung der 5000« war deshalb so populär, weil da
zwei symbolische Fische und eine Menge Wasser genügten, um tausende
Leute zu beköstigen. Das war die Geburtsstunde des Fast Food: Fischaroma
mit Wasser aufgießen, und die Konsumenten rufen Hosianna.
Übrigens nicht nur in den Städten. Die Bauern in meiner Nachbarschaft
benutzen Retortenprodukte nach meinen Beobachtungen exzessiver als Städter,
denen eine größere Auswahl an frischen Lebensmitteln zur
Verfügung steht.
* Die Bequemlichkeit beim Töten: George Orwell behauptete,
daß der Erste Weltkrieg ohne die Erfindung der Konservennahrung
nie hätte stattfinden können. Er klagte die Konservennahrung
an, die Gesundheit der Engländer zu ruinieren: »Es könnte
sich herausstellen, daß Konservennahrung langfristig gesehen eine
tödlichere Waffe ist als das Maschinengewehr.«
Nun ja, Orwell war auch ein Spaßvogel. Er hat die Gefährlichkeit
der Konserve wohl überschätzt. In einer Packung tiefgefrorener
Fischstäbchen hätte er wahrscheinlich ein Massenvernichtungsmittel
gesehen. Was sie ja auch ist, weil nämlich dafür die Fische
in Massen vernichtet werden.
* Die Fertigkost löste uns vom Herd, machte uns mobil, und
wenn es nicht gerade um so unerfreuliche Unternehmen wie Kriege geht,
hat das auch gewisse Vorteile - großangelegte Expeditionen in
unwegsame Gegenden wie zum Pol oder zum Himalaja wären ohne Fertigkost
nicht möglich. Ohne Nahrung aus der Tube könnten wir nicht
in den Kosmos fliegen.
Du liebe Güte! Wenn ich etwas für total überflüssig
halte in der Entwicklung der Menschheit, dann sind es Expeditionen zum
Pol und die Raumfahrt.
* Sie glauben also nicht, daß sich mit der Entwicklung
von Fast Food zunächst Hoffnungen verbanden? Daß - wie bei
allen Erfindungen - der Segen und nicht der Fluch gewollt war?
Wo sehen Sie bei der Erfindung der Gummibärchen einen Segen? Gewollt
war der Profit. Fast Food ist eine große, eine riesige Industrie,
über deren Ausmaß und Macht wir kaum eine Vorstellung haben.
Die Nahrungsmittelkonzerne haben in Brüssel die größte
Lobby, da sie mit der Agrarlobby praktisch an einem Strang ziehen. Ihrem
Power-Marketing eine Kultur des individuellen Geschmacks entgegenzusetzen,
ist fast aussichtslos. Nur Nischen scheinen möglich, in denen die
Qualität gehütet wird wie ein Gral. Allerdings sind die Menschen
immer noch aller Ideologien überdrüssig geworden, die man
ihnen aufzwang oder wozu man sie überredet hat. Darin liegt eine
Hoffnung. Eine schwache Hoffnung, wie ich zugebe.
* Trotzdem: Für die Arbeiterin der Jahrhundertwende war
die Suppendose Zeitersparnis. Und genau aus diesem Grunde greift die
berufstätige Frau unserer Tage zur Tiefkühlkost - Brühwürfel,
Kantine und Mikrowelle sind Attribute der Arbeitsgesellschaft. Insofern
steht das Fertiggericht auch für eine Demokratisierung des Essens.
Reden Sie nicht von Arbeitsgesellschaft! Wir sind eine Arbeitslosengesellschaft.
Sie können die Fabrikarbeiterin der Jahrhundertwende doch nicht
mit unseren berufstätigen Frauen vergleichen! Damals waren Wasch-
und Spülmaschine noch nicht erfunden, gab es noch keine 35-Stundenwoche
und keine Teilzeitarbeit. Pampers hießen Windeln und wurden von
Hand gewaschen, Babynahrung produzierte die Mutter, Töpfe wurden
mit Sand gescheuert, und Meister Proper war unvorstellbar.
Gewiß dienen unsere HighTech-Küchen der Zeitersparnis, wie
das Fertiggericht auch. Aber wofür wird die Zeit denn gespart?
Was fängt die Hausfrau damit an? Ich will es Ihnen sagen: Sie drängt
sich in eine Talk-Show und redet über ihre erogenen Zonen. Sie
fliegt am verlängerten Wochenende zum Billigtarif nach Venedig.
Sie verbringt ihre Zeit in Selbsterfahrungsgruppen. Sie macht tausendundeine
Sache.
Nur kochen tut sie nicht. Dafür gibt es ja Fast Food. Wenn Sie
das Demokratisierung des Essens nennen, dann kann ich nur lachen. Für
mich ist das Unterwerfung unter die Verführungen des Konsums auf
Kosten wirklicher Lebensqualität.
* Wirkliche Lebensqualität - das ist also kochen?
Ja - aber das muß ich präzisieren. Unter kochen verstehe
ich in diesem Zusammenhang die Befreiung von fremdbestimmter Arbeit.
In keinem anderen Bereich unseres Lebens haben wir die Möglichkeit,
Arbeit selbst zu bestimmen. Das heißt, wir selbst treffen die
Entscheidung, was wir kochen, wir selbst wählen die Produkte, verarbeiten
sie nach unserem Gusto - möglichst ohne ängstliche Blicke
ins Kochbuch -, wir schaffen Lustgewinn aus eigener Kraft! Das gibt
es sonst nur noch in der Kunst; aber wer ist schon ein Künstler?
Dabei muß keineswegs ein raffiniertes Gourmet-Menü 'rauskommen.
Wenn es gelingt: um so besser. Aber schon ein Fleischklops kann unendlich
mehr Freude machen, wenn er selbstgemacht ist, als ein Fleischklops
mit Verfallsdatum aus der Gefriertruhe. Der Mensch braucht die Freiheit,
selbst zu entscheiden, wie und was gekocht wird; er sollte seinen eigenen
Geschmack artikulieren und sich nicht einem Konfektionsgeschmack unterwerfen.
Andernfalls wird er depressiv. Deshalb ist Kochen so wichtig für
unsere psychische Hygiene, und deshalb ist Fast Food so fatal. Fast
Food ist Essen für Befehlsempfänger.
* Kochen als kleiner Schöpfungsakt. Unsere Töchter
und Söhne allerdings scheinen kaum noch bereit und in der Lage,
sich ihre Nahrung selbst zuzubereiten - die Freiheit scheint sie nicht
zu reizen.
Da habe ich eine bessere Meinung von den Jungen. Wenn die sich überhaupt
noch vom Elternhaus beeinflussen lassen, dann ist es durch Mamas Kochkünste.
Wo die noch richtig kocht, werden bleibende Eindrücke, ja Sehnsüchte
installiert. Das war auch früher nicht anders. Leider sind schon
viele, viel zu viele Mütter auf dem Fast Food Trip, und die Erinnerung
daran bewirkt bei den Kindern keine Sehnsucht, sondern Gleichgültigkeit
gegenüber ihrer Ernährung.
* Ich möchte Ihnen ja gern glauben, daß die kleinen
Skins entstehen, weil Mama nicht mehr richtig kocht. Doch da muß
ich an Herrn Hitler denken: Obwohl er den Fleischklops abgelehnt hätte,
weil er Vegetarier war, war er doch sehr fürs Selbstgemachte: für
naturnahe Kost, »artgemäße Ernährung«, derer
das deutsche Volk bedürfe, »um seine Zukunft groß und
stark zu gestalten«. Gleichschaltung per Gaumenkitzel - hausgemachte
Kartoffelsuppe macht Menschen offenbar auch nicht mündig.
Das ist ein interessanter Einwand, jedenfalls für Leute wie mich,
die im Elternhaus Hitlers Eintopfsonntage kennengelernt haben. Damals
war alles noch selbstgemacht; neu war nur die Aufforderung zum primitiven
Essen. Die »artgemäße Ernährung« propagierten
die Nazis, weil die Aufrüstung Devisen verschlang, die man nicht
für Delikatessenimporte ausgeben wollte. Also gewöhnten sich
die Volksgenossen an Margarine, an fehlende Sahne und an deutsche Rüben.
Der damit einhergehende Blut-und-Boden-Rummel war, was heute das Tätowieren
bei Skindheads ist: ästhetisch geschmacklos und ideologisch dämlich.
Aber, wie ein Satiriker später spottete: »Eßt Scheiße!
Millionen Fliegen können sich nicht irren.«
Die Blut-und-Boden-Mentalität ist leider nicht tot, und ihre Kategorien
werden immer noch mit artgemäß, natürlich, echt, unverfälscht
undsoweiter bezeichnet, auch und gerade beim Essen. Unverfälscht!
Echt! Natürlich! - man kann gar nicht genug kreischen, wenn heutige
Einfaltspinsel unsere Ernährung so bezeichnen. Nichts ist mehr
echt und natürlich; was immer wir in den Mund stecken, ist manipuliert,
verfälscht, unnatürlich und belastet; nicht nur Fast Food.
Es wäre schrecklich, wenn die Forderungen der Ökologen nach
naturbelassenen Lebensmitteln mit der Blut-und-Boden-Mythologie gleichgesetzt
würden.
* Noch einmal zurück zu den Jungen: Egal, ob Mama nun kocht
oder nicht, sie sind die Hauptkunden von McDonald's. In nur 25 Jahren
hat sich der US-Konzern an die Spitze der deutschen Schnellgastronomie
gesetzt.
Meine Kinder haben McDonald's verabscheut. Dennoch hat der Erfolg von
McDonald's kaum mit dem Geschmack der Hamburger zu tun. Er ist eineArt
Kulturrevolution, die Jungen rennen hin, weil sie sich von ihren Elternunterscheiden
wollen. Genau wie sie Hea~vy Metal und andere Popmusik hören, die
Erwachsene in die Flucht schlägt. Im schrillen Plastikambiente
einer McDonald's Filiale sind sie unter sich, da achtet niemand darauf,
ob sie sich lümmeln, da essen sie mit den Fingern, weil es anders
ja gar nicht geht. Daß das für geschmackliche Emanzipation
nicht förderlich ist, ist klar. Leider bewirkt die allgemeine Infantilisierung
unserer Gesellschaft auch bei Erwachsenen eine Vorliebe für die
Wattebrötchen. In den USA stört sich niemand daran, wenn der
Präsident in so 'n Ding beißt und dazu aus einem Pappbecher
trinkt. Nun ja, die Amerikaner finden einen Bayern hinter seinem Maßkrug
und einer Schweinshaxn wohl auch nicht gerade beispielhaft für
das Volk der Dichter und Denker. Nicht jeder empfindet eben den Wohlstand,
in dem er lebt, als Verpflichtung zur kulturellen Weiterentwicklung.
* Der Hamburger ist ein Kultobjekt, und längst sind Fast-Food-Restaurants
die Plätze, an denen die Trash-Kultur lärmend den schlechten
Geschmack feiert.
Habe ich je etwas anderes behauptet?
* Nein, aber es könnte doch sein, daß das Bekenntnis
zum Hamburger das trotzig-ironische Bekenntnis der grauen Masse zu sich
selbst ist.
Liebe Frau Matte! Ich weiß nicht, ob sie eine Katze oder einen
Hund haben. Wenn ja, heißt das Tier wahrscheinlich McDonald's,
stimmt's? Ihre Fragen zeigen, daß Sie auf Hamburger geradzu fixiert
sind. Macht ja nichts; ich habe auch meine Ticks. Nur hat das einen
Nachteil: Ich interessiere mich nur am Rande dafür. In Wirklichkeit
ödet mich diese Fast-Food-Kultur an, für so was bin ich, was
mir zu Recht vorgeworfen wird, zu elitär. Ich beschäftige
mich mit dem Kulinarischen nicht, um Gummibärchenkonsumenten in
die Pfanne zu hauen, sondern um Feinschmecker zu ermutigen.
* Also, ich habe eine Katze. Die heißt nicht McDonalds.
Aber da Sie das Thema satt haben, reden wir über was anderes: Was
macht gute Küche aus?
Das ist eigentlich nicht schwer zu definieren, weil es beim Kochen
wie in der Musik oder Malerei objektive Maßstäbe gibt. Mozart
ist nun mal besser als Paul Lincke, darüber herrscht ebenso Einigkeit
wie über die herausragende Stellung eines Michelangelo, eines Holbein
oder Max Ernst gegenüber einem Comic. Um das zu erkennen, bedarf
es allerdings einer Bildung, die man nicht per Schluckimpfung erwirbt.
Beim Essen ist es nicht anders. Niemand wird als Feinschmecker geboren.
Die Tatsache, daß wir alle unsere Lieblingsspeisen haben, besagt
wenig. Die meisten Menschen sind zufrieden, wenn sie ihre Lieblingsspeise
täglich auf dem Teller haben, auch wenn es eine Currywurst ist.
Den Herstellern von Currywürsten paßt das natürlich
gut ins Kozept, und sie beten heimlich, daß sich daran nichts
ändert. Deshalb sind sie im Grunde fortschrittsfeindlich, auch
wenn sie immer modernere Wurstmaschinen in Betrieb nehmen. Sie ähneln
darin allen Institutionen, die in unserer Welt die Macht haben.
* Selbst kochen und gut kochen, das sind zunächst einmal
Äpfel und Birnen. Wo haben Sie kochen gelernt?
Selbst kochen bedeutet lediglich, daß man nicht zu vorgekochter,
konfektionierter Nahrung greift. Es kann - vielleicht - Ausgangspunkt
für eine ehrgeizige, bessere Küche sein. Muß aber nicht.
Dennoch ist die Verweigerung der Industrieprodukte positiv, weil sich
darin das Unterscheidungsvermögen des Verbrauchers zeigt. Besser
kochen ist ohne kulinarischen Anspruch nicht möglich, und der setzt
Unzufriedenheit voraus. An diesem Punkt kommt die kritische Zunge ins
Spiel, wird Kritik zu einem progressiven Impuls. Denn nichts besiegelt
die Verblödung unserer Gesellschaft mehr, als kritiklose Akzeptanz
der Dinge, die man uns vorsetzt - das gilt fürs Entertainment und
die Politik noch mehr als beim Essen.
Als Koch bin ich Autodidakt. Ich war einfach nicht zufrieden mit dem,
was es um mich herum zu essen gab, also habe ich zunächst für
meine eigene Lust gekocht, schließlich aus Neugier und als Broterwerb,
indem ich übers Kochen schrieb. Das tue ich heute noch. Natürlich
habe ich ein paar Nachhilfestunden in den Küchen guter Profiköche
genommen.
* Gute Küche braucht mehr als Salz in der Suppe, man braucht
erstklassige Nahrungsmittel. Wo findet man die?
Soll ich jetzt Läden nennen, die darauf spezialisiert sind? Märkte,
wo Bio-Bauern ihre Produkte verkaufen? Bäcker, die Brote backen,
welche auch nach 14 Tagen noch eßbar sind? Es gibt bei uns alles.
Nicht überall, aber man kann es finden. Doch das kostet Zeit und
Mühe. Und da steigen schon die ersten Konsumenten aus; deshalb
ist Fertignahrung so populär: Man hat keine Mühe, das Zeug
zu finden.
* Die Gen-Tomate kommt nicht auf Ihren Tisch?
Ich hoffe nicht. Aber wer weiß schon, was sie uns alles andrehen?
Genfreie Nahrungsmittel wird es bald wohl nicht mehr geben. Das genmanipulierte
Zeug wird ja zugelassen, weil es so ungefährlich ist wie die Castor-Transporte.
* Was muß passieren, damit es sich für Bauern wieder
lohnt, ökologisch vernünftig zu wirtschaften?
Fragen Sie mal die Bio-Bauern, von denen es in Deutschland und Österreich
ja schon sehr viele gibt! Unfreiwillig tragen wohl auch die Genmanipulierer
dazu bei, daß die Verbraucher mehr und mehr nach Bio-Produkten
suchen. Es existieren sogar schon Führer zu den entsprechenden
Höfen im Umkreis der großen Städte. Doch am Anfang jeder
Veränderung zum Besseren stehen die Ansprüche der Verbraucher.
* Können wir als Verbraucher wirklich Einfluß darauf
nehmen?
Aber ja doch. Nehmen wir schon seit Jahren. Wieso gäbe es sonst
die wunderbaren Märkte, die Überfülle an Delikatessen,
die vielen Biomärkte und Geschäfte? Wer einmal den Unterschied
geschmeckt hat zwischen einem fetten Suppenhuhn und einer ausgemergelten
Henne aus der Batteriehaltung, der läßt sich so leicht kein
Turbohähnchen mehr andrehen.
* Sehen Sie in absehbarer Zeit eine Chance, erstklassige Nahrungsmittel
wieder zum Allgemeingut zu machen?
Nein, sie werden weiterhin eine Randexistenz führen, wie eigentlich
zu allen Zeiten. Zwar gab es Epochen, in denen allgemein besser gegessen
wurde, aber die zum besseren Essen nötigen Produkte waren nie Allgemeingut.
Dafür sorgte schon das ewige Wohlstandsgefälle.
* Es werden immer wenige bleiben, die ein gutes Essen schätzen?
Es ist immer nur ein kleiner Prozentsatz der Gesellschaft, der Wert
auf gutes Essen legt. Der hat zwar eine große Vorbildfunktion
und beeinflußt die Qualität des Marktangebots sowie das Niveau
der Gastronomie. Aber wie das Sprichwort schon sagt: Man kann die Pferde
zur Tränke führen, aber zum Saufen zwingen kann man sie nicht.
* Sie sprachen davon, daß man seinen Wohlstand auch als
Verpflichtung zur kulturellen Weiterentwicklung empfinden könne.
Wie reagiert die gehobene Küche auf den anhaltenden Trend zum schnellen
und geschmacklosen Essen?
Sie reagiert überhaupt nicht, wenn Sie damit die Spitzengastronomie
meinen. Allenfalls tauscht sie mal die Gänseleber gegen Ochsenschwanz
aus und senkt entsprechend ihre Preise, wenn die Konjunktur nachläßt.
Das ist zum Beispiel jetzt zu beobachten. Auch in sogenannten Luxusrestaurants
können Sie mittags ein sehr preiswertes Menü essen; wobei
dieser Begriff natürlich relativ ist. In einer Kneipe ist es zwangsläufig
noch billiger.
* Aber das Fernsehen reagiert - mit einer Flut von Feinschmeckersendungen.
Das Beste, was man diesen Sendungen nachsagen kann, ist, daß
sie das Interesse am Selberkochen wecken und nur selten Fertigsaucen
oder -gewürze propagieren.
* Wie finden Sie Biolek?
So schlimm wie Frau Herzog ist er nicht, aber mindestens so eitel wie
Lafer .
* Müssen einen die Versuche, wieder eine hausgemachte, schmackhafte
Kost zu etablieren, nicht an die Haute Couture erinnern, die mit Nadel
und Faden vergeblich versucht, ein verblichenes Zeit~alter wiederzubeleben?
Nein, Haute Couture ist bestenfalls mit der Gourmet-Gastronomie zu
vergleichen, welche allerdings erschwinglich ist, wenn man dafür
spart. Ich würde solche Versuche mit dem Frosch vergleichen, der
in der Milch strampelt, bis diese zu fester Butter wird und ihm so das
Entkommen ermöglicht.
* Wolfgang Joop ist überzeugt: Jeder Trend, wenn er entsteht,
trägt bereits den Gegentrend in sich.
Den Gegentrend zum Fast Food gibt es seit Jahren. Er heißt Slow
Food und ist die Erfindung italienischer Genießer. Seine Wirkung
ist leider gering; es ist ein Verein daraus geworden.
* In Deutschland, heißt es, sei eine neue Lust am Kochen
entstanden. Entwickelt sich Kochen zum neuen Volkssport?
Schön wär's. Wir Deutsche sind seit Jahrhunderten für
vieles berühmt und berüchtigt. Unsere Kochkünste hat
jedoch noch niemand bemerkt oder gelobt. Abgesehen vom Bismarckhering
und dem Fürst Pückler Eis haben wir zur Geschichte der Kochkunst
nichts beigetragen. Das wird auch so bleiben.
* Was macht Sie so sicher?
Unser Hang zur Tiefe, zum Dunklen und Dramatischen, unsere Schwerfälligkeit
und Mangel an Witz - all das macht es uns schwer, leichthin zu genießen.
Die Lust am Kulinarischen ist heiter, Kochen verspielt. Und genau da
hapert's bei uns.
* Egal, ob man Fast Food favorisiert oder mit der Verfeinerung
des guten Geschmacks beschäftigt ist: Bekommt man nicht ein schlechtes
Gewissen, daß es ganze Kontinente gibt, denen noch der Magen knurrt?
Kommen Sie mir bloß nicht mit dieser abgedroschenen Litanei!
Erstens hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun; kein
Hutu wird davon satt, wenn wir schlecht essen. Zum anderen ist das ein
typischer protestantisch-puritanischer Einfall: Buße tun, weil
man Spaß hatte!
Das schlechte Gewissen beim Verzehr einer Wachtel ist eine deutsche
Anomalie. Kein Italiener und kein Franzose käme auf die Idee, einen
Zusammenhang zwischen seiner Lust am Essen und der Armut anderer herzustellen.
Auch bei zwölf Prozent Arbeitslosen, die es in Frankreich noch
schlechter haben als bei uns, sind die Tageszeitungen dort voll von
Berichten über Luxus, über Foie gras und Juwelen, und niemand
nimmt Anstoß. Bei uns aber kann man gar nicht so schnell »Kaviar«
sagen, wie einem die Hungernden in der Dritten Welt vorgehalten werden.
Haben Sie denn ein schlechtes Gewissen, wenn Sie autofahren? Die Armen
haben keine Autos. Die haben auch keine Wintermäntel, keine Sommerkostüme
und keine hochhackigen Schuhe, wie sie in dieser Saison Mode sind. Haben
Sie deshalb ein schlechtes Gewissen? Natürlich nicht. Aber sobald
jemand bekennt, daß er lieber Spargel ißt als Grünkohl,
trifft ihn der geballte Zorn der Savonarolas . Diese deutsche Reaktion
auf kulinarische Ansprüche behindert eine Verbesserung unserer
Küche wahrscheinlich mehr als die Verbreitung von Fast Food.
* Herr Siebeck, verraten Sie zum Schluß, wie Sie einen
Fleischklops zubereiten!
Das muß ich als Buchautor verweigern. Kaufen Sie meine Bücher,
da steht es drin.
|